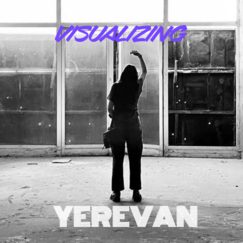Relikte einer (anderen) Zukunft? - Das Nachleben der sozialistischen Stadt in Zentralasien und im Südkaukasus

Drei Jahrzehnte nach dem Fall des Systems, dem sie einst ihre Existenz schuldete, ist die Materialität der Sowjetzeit heute gleichzeitig Relikt der Vergangenheit und Mahnmal einer unvollendeten Zukunft in einem sich rapide verändernden, neoliberalen Stadtraum. Wie im Fall anderer gefallener Reiche überdauert das architektonische Erbe das System, dem es seine Existenz verdankt – aber gilt dies auch für die Ideen, die in das städtische Gefüge eingewoben sind?
Das Projekt "Relikte einer (anderen) Zukunft" untersucht, wie die sowjetische Urbanität als physisches Relikt des Ancien Régime das soziale Leben in postsowjetischen Städten heute bestimmt. Stadtraum wird als "umkämpfte Geographie" verstanden, in der miteinander konkurrierende Vorstellungen von Vergangenheit und Zukunft im Raum verankert und gelöst werden. Ziel ist es, den Antagonismus sozialistischer Zukunftslandschaften und ethnonationaler Vergangenheitslandschaften in seiner Vielschichtigkeit abzubilden. Hierbei werden semiotische Risse in der Oberfläche der neu geschaffenen Nationallandschaften aufgespürt. Gleichzeitig wird untersucht , wie die "unvollendete Zukunft" des sozialistischen Projekts Jahrzehnte später alternative Geschichtsbilder mobilisieren kann, welche den heute vorherrschenden ethnozentrischen Diskurs herausfordern können.
Hierzu befasst sich das Projekt mit zwei exemplarischen Schauplätzen des städtischen Raums in ehemaligen „sowjetischen Süden“: dem Südkaukasus (Jerewan, Armenien) und Zentralasien (Bischkek, Kirgisistan). Dort untersucht es die mobilisierende Kraft, welche der "materialisierten Erinnerung" der Sowjetzeit in einem Spannungsfeld aus steigendem Populismus, politischer Entfremdung und konkurrierenden Zukunftsvisionen innewohnt.
Aus dem Projekt soll eine zweite Monographie Life After Future - Unmarginalizing Urbanities from the Former Soviet South South (vorläufiger Titel) hervorgehen. Ausgehend von der Frage - What is Left of the Socialist City? - geht es in diesem Buchprojekt nicht nur darum, den materiellen und erinnungswissenschaftlichen Relikten der sozialistischen Stadt nachzuspüren, sondern auch aufzuzeigen, wie der sowjetische Diskurs über die Stadt radikale Ideen hervorbrachte, die zuweilen die engen Grenzen des Staatssozialismus selbst in Frage stellten. Dazu gehören beispielsweise die Bemühungen der Esperanto sprechenden Internationalisten aus der Tschechoslowakei, in der zentralasiatischen Steppe eine internationalistische Stadt quasi bottom-up aufzubauen, das Bestreben armenischer Futuristen, den architektonischen Stil Sowjetarmeniens im persischen Erbe der Region zu verwurzeln, oder die Vision eines jüdisch-kirgisischen Philosophen, eine Wissenschaftsstadt im Hinterland Moskaus in die erste Ökopolis der UdSSR zu verwandeln. Zwischen den antagonistischen Polen der spektakulären Verwirklichung und des kolossalen Scheiterns, versteht das Projekt südsowjetische Urbanität nicht als in sich geschlossenes, rigides Bedeutungssystem, sondern als eine Pluralität fragmentierter Erfahrungsstränge, die zusammen eine polyphone Darstellung dessen ergeben, was Erfahrungen mit sozialistischer Urbanität in den südlichen Republiken der Sowjetunion bedeutete. Schließlich wendet sich das Buch der krisengeschüttelten 'Jetztzeit' zu und schließt mit der Frage: Was bedeutet es, drei Jahrzehnte nach dem Ende des Staatssozialismus Städte zu bewohnen, die für eine unvollendete und verworfene Zukunft gebaut wurden?